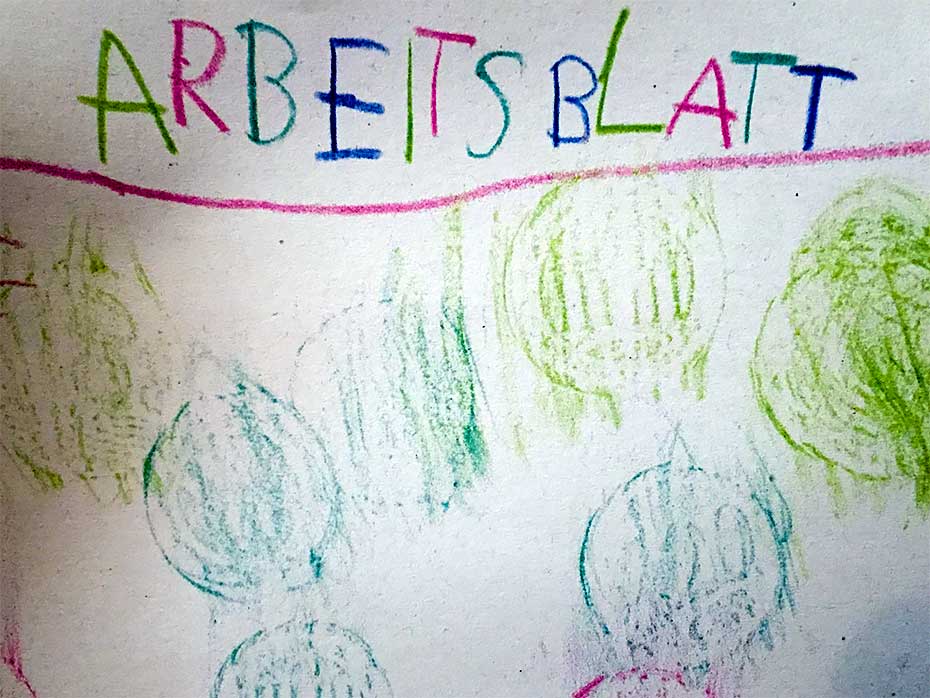
Von Epoche zu Epoche verändert sich immer wieder der Begriff des Lernens. Die Attribute, die dabei dem Lernen zugewiesen werden, ergeben sich aus Beschreibungen des Denkens.
Sinngebung früher
In der Vergangenheit – bis hinein ins 20. Jahrhundert – wurde immer wieder das Bild des Baumes mit seinen sinngebenden Wurzeln, einem starken Stamm und den diäretischen Zweigen bemüht. Erkenntnisse aus solchen kausalen und linearen Zusammenhängen wurden mit dem Prädikat ‚systematisch‘ versehen und lektionenweise in Lehrbüchern wiedergegeben. Das Lernen war an An- und Unterweisung gebunden. Der Lehrer stand instruierend im Zentrum des mechanistischen Lernarrangements namens Schule.
Hierarchien überwinden
Inzwischen werden die Früchte der Erkenntnis aber auch von anderen Gebilden gepflückt. Myriaden von Myzelien werden an den Wurzeln der Bäume ausgegraben und auf ihre Wechselwirkung zum Baum hin untersucht. Das Ergebnis sorgt noch immer für Irritation unserer Vorstellungen von Hierarchie und Taxonomie. Das Informationszeitalter hat damit seine Metapher gefunden. ‚Rhizomatisch‘ spürt man dem Denken in Nervenbahnen nach und spannt ‚systemische‘ Netze, in denen das Lernen entdeckt wird. Als forschend und fokussiert auf ein Problem werden die Subjekte beschrieben. In Projekten entfalten sie die entsprechenden Prozesse. Das wird sichtbar in der zeitgemäßen Schule.
Ich empfehle die Freie Schule Christophine.
Lernen im digitalen Zeitalter
Subjekte in Lernprozessen? Solche mögen vielleicht Bildungsforscher unter dem Mikroskop auf ihren Objektträgern finden – Schülerinnen und Schüler aber sind mehr. Sie sind der Souverän ihres Lernens, zu dem sie während ihrer Zeit in der guten Schule auf Basis nachhaltiger Erfahrungen ein anhaltendes Verhältnis entwickeln. Während ihre Vorfahren ihren Schulranzen jeden Morgen noch in ein bivalentes Lernsystem trugen, dessen Logik allein den Werten von richtig und falsch folgte, wachsen sie – trotz aller binären Algorithmen, die uns umgeben – auf in einer mehrdeutigen Welt, für deren Aneignung sie auch vor emergenten Gedankengängen nicht zurückschrecken und mehrfachcodierte Zeichen zu ertragen wissen.
Offene Lernwege
Von absoluten Wahrheitsansprüchen vermögen sich die Schulkinder an der guten Schule irgendwann zu verabschieden. Ihr Denken entwickeln sie anhand eigener Fragestellungen auf eigenen Lernwegen. Sie sind nicht abhängig von vorgelegten Materialien und buchstabieren im Austausch mit anderen Schulkindern auch Ergebnisse, die in ihrer Ausgangssituation noch gar nicht zu erkennen waren. Selbstbestimmte Lernsettings mit unterschiedlichen Modi – was bearbeite ich wo und mit wem – und vielfältige Situationen von sozialen und fachlichen Aushandlungen im Austausch mit Partnern und Pädagogen sorgen für ureigenste Relevanzerfahrungen, die dem Lernen ein Leben lang eine Signatur geben können.
Selbstbestimmt und mutig
Die gute Schule will Kindern des 21. Jahrhunderts ein Lernort sein, an dem sie ihre Alltagserfahrungen mit denen ihres schulischen Lernens abgleichen können. Das Leben und die Schule werden von hier nicht als sich widersprechende Systeme erfahren, sondern als sich ergänzende Bedeutungsräume verstanden, in denen Erkennen anschaulich wird und Sinn gestiftet werden kann.
Lernen ist dann mehr als nur Zuwachs von Wissen, das den Widrigkeiten des Vergessens ausgesetzt ist. Lernen sorgt vielmehr für einen Fundus an Optionen, mit denen man gestärkt den Herausforderungen der Zukunft entgegentreten kann. Und das auch noch in einer Zukunft, von der wir heute noch nicht wissen, wie sie aussieht. Der anstehende Übertritt in die weiterführende Schule legt uns ihren Beginn jeweils nahe.