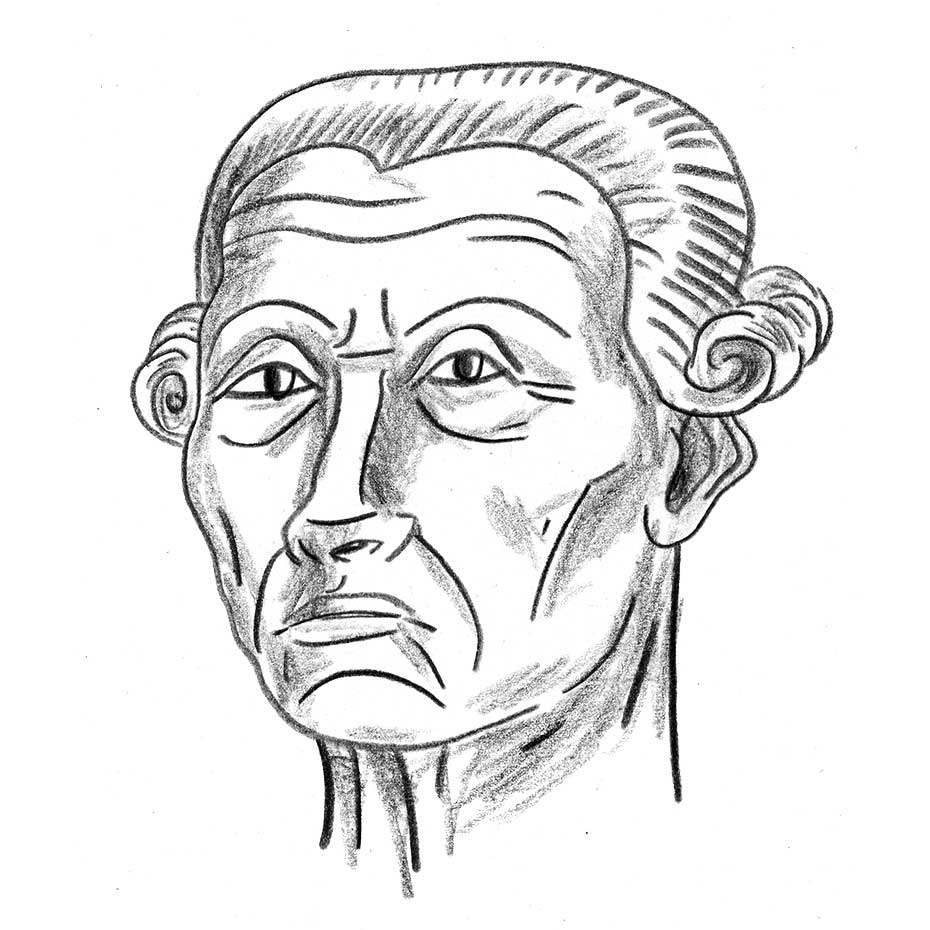
Zeichnung von Jolanda Obleser
Es war Immanuel Kant, der es formulierte: „Alle Cultur fängt von dem Privatmanne an und breitet von daher sich aus.“ ‚Über Pädagogik‘ heißt die 1803 erschienene Schrift, die man als Fanal zur Gründung einer anspruchsvollen Privatschule lesen kann. Kant zweifelte an der allein durch den Fürsten finanzierte Schule, da diese nicht das „Weltbeste“ beabsichtige, sondern nur zum Wohl des Staates lehre. Er ergänzte seine Vorbehalte mit der Behauptung, die existierenden Schulen seien „verdorben“, „weil alles darin der Natur entgegen arbeitet, dadurch bei weitem nicht das Gute aus dem Menschen gebracht werde, wozu die Natur die Anlage gegeben.“ Anders als der in den Mühlen der Bildungsbürokratie wirkende Wilhelm von Humboldt schien Immanuel Kant geradezu ungeduldig, denn er forderte keine „langsame Reform, sondern eine schnelle Revolution“. Wir jedoch beruhigen: Jeder in seinem eigenen Tempo, sagt sich der Privatmanne mit Blick auf den etwas behäbigeren liberalen Staat. So wurde 2009 die Freie Schule Christophine gegründet.
Einmal hatte Kant drei Positionen markiert, die er für unerlässlich hielt, um die gute Schule festzuzurren. Die gute Schule solle so konzipiert sein, „1) daß man das Kind von der ersten Kindheit an in allen Stücken frei sein lasse (ausgenommen in den Dingen, wo es sich selbst schadet, z. E. wenn es nach einem blanken Messer greift).“ Die Marbacher Pädagogik schließt dort an Kant an, wo sie die Möglichkeiten des Lernens so konzipiert, dass die Schulkinder vor Unbill mit den Erwachsenen, die als Erzieher Repräsentanten von gesetzten Regeln darstellen, gefeit sind. Gefahren fürs Unversehrte müssen bestimmt sein, für die Schulkinder ersichtlich sein: der Zugang zum „blanken Messer“ sollte nicht gedankenlos möglich sein, der Sinn eines jeden Werkzeugs für die lernenden Nutzer verständlich sein. Im Arbeitsraum wie im kompetenzorientierten Miteinander werden Orientierungen gegeben, die das Lernen hoch achten und schöpferische Impulse dementsprechend provozieren und ermöglichen.
Die Erwachsenen charakterisieren sich dann als einflussreiche Parameter der Lernkultur im Schulsaal, die den Kindern zeigt, „2) daß es seine Zwecke nicht anders erreichen könne, als nur dadurch, daß es Andere ihre Zwecke auch erreichen lasse“ (Kant). „Störe mich nicht, ich arbeite“, lautet die Formel, die ein noch nach Sicherheit im schulischen Lernen suchendes Kind in der Haltung der souveräneren Kameraden im Laufe seines Hineinwachsens in den Schulsaal erkennen muss.
Marbacher Pädagogik hebt den Habitus des Schultuns im Begriff der Tischarbeit ohne Schnörkel hervor. Ohne andere Arbeit auszuschließen ist auf der täglich strukturgebenden Tafel in der Handschrift der Kinder „rechnen & schreiben“ zu lesen. Diese Prioriserung steht im schulhistorischen Zusammenhang mit der Entwicklung von Bildungsplänen und Curricula, wie sie sich auf der Stundentafel der etablierten Schule durch die Kernfächer Mathe und Deutsch abbilden. Beispielhaft und gleichzeitig hervorhebend wird so die Aufmerksamkeit der Schulkinder auf klassisches Schultun und die damit einhergehenden Kulturtechniken gelenkt.
Immanuel Kant sollte staunen, wie vielfältig die Schulkinder diesem Anspruch folgen. Sicher würde er versuchen, angesichts eines knietief in Wogen von Wellpappe bastelnden Erstklässlers sein pikiertes Kopfschütteln zu verbergen. Aber nicht erst, wenn der Kleine sich bei einem Großen, der kein Erwachsener sein muss, Hilfe holt, um dazu einen Gedanken schriftlich zu fassen, könnte Kant bezeugen, welch hochwertige Arbeitsleistung hierfür erforderlich ist. Ließe er sich dann noch durch die Versuche der einen im Hunderterfeld, der anderen an der Stellenwerttabelle bestätigen, würde er anerkennend mit seinem Stock auf Holz klopfen, sich tapfer auch noch ein Exzerpt über Dinosaurier, Sittiche oder Dachshunde anhören. Geschichten aus dem Sternenkriegerkosmos blieben ihm vermutlich fremd. Bei der Trainingskonferenz Breakdance würde er rasch seine Schulinspektion beenden und an seine letzte pädagogische Marke erinnern, man müsse dem Kind „3) beweisen, daß man ihm einen Zwang auflegt, der es zum Gebrauche seiner eigenen Freiheit führt, daß man es kultiviere, damit es einst frei sein könne, d. h. nicht von der Vorsorge Anderer abhängen dürfe.“ Ja, sagt Christophine zum Abschied, an diesem Beweis arbeiten wir. Schauen Sie doch in einem halben Jahr wieder vorbei. Der pädagogisch versierte Privatmanne weiß um die Winkelzüge des Lernens von Kindern, begleitet in der Schule ihre Umwege, ahnt ihre Sackgassen und verweist gemäß der durch die Marbacher Pädagogik auferlegten Zurückhaltung im Unterricht vornehmlich auf die Pfade, die andere Kinder bereits angelegt haben und erfolgreich gegangen sind.
Wie die Schulkinder im Probieren eigene Methoden entwicklen können oder entsprechend der Marbacher Pädagogik aufgefordert sind, ihr ureigenstes Verständnis angesichts origineller Rechenwege und Leseerfahrungen für Bildung zu entwickeln, weiß auch Christophine keine Methode vorweg als die geeignetste zu offerieren. Der Grundsatz der Marbacher Pädagogik, die für uns Erwachsene größtmögliche didaktische Offenheit zu gewährleisten, verweigert sich gegenüber der richtigen Methode, begründet sich vielmehr in dem Wissen, das Kant formulierte, „‚daß, da es auf Experimente ankommt, kein Menschenalter einen völligen Erziehungsplan darstellen kann.“
Infolgedessen und seinerzeit, ganz angetan von einem Schulversuch eines Privatmannes in Thüringen, rief Immanuel Kant dazu auf, für dieses Unterfangen Geld zu spenden: „Der guten Meinung zufolge, die wir uns von der Zahl wohl denkender Personen unseres gemeinen Wesens machen, sehen [wir] einer zahlreichen Pränumeration entgegen: von allen Herren des geistlichen und Schulstandes, von Eltern überhaupt, denen, was zu besserer Bildung ihrer Kinder dient, nicht gleichgültig sein kann, ja selbst von denen, die, ob sie gleich nicht Kinder haben, doch ehedem als Kinder Erziehung genossen und eben darum die Verbindlichkeit erkennen werden, wo nicht zur Vermehrung, doch wenigstens zur Bildung der Menschen das ihrige beizutragen.“
Einmal mehr sieht sich Christophine anschlussfähig an Immanuel Kants pädagogische Ausführungen. Die Anerkennung seiner Worte stärkt den eigenen aufklärerischen Duktus. Der Mausklick ins Onlineportal der Sparkasse sei handlungsorientiert als Tat infolge empfohlen. Unterstützen Sie die Marbacher Pädagogik. Spenden Sie für Christophine. Bildung ist nie umsonst.
Freie Schule Chrisophine e.V. Kreissparkasse Ludwigsburg · SOLADES1LBG · DE32604500500030052011