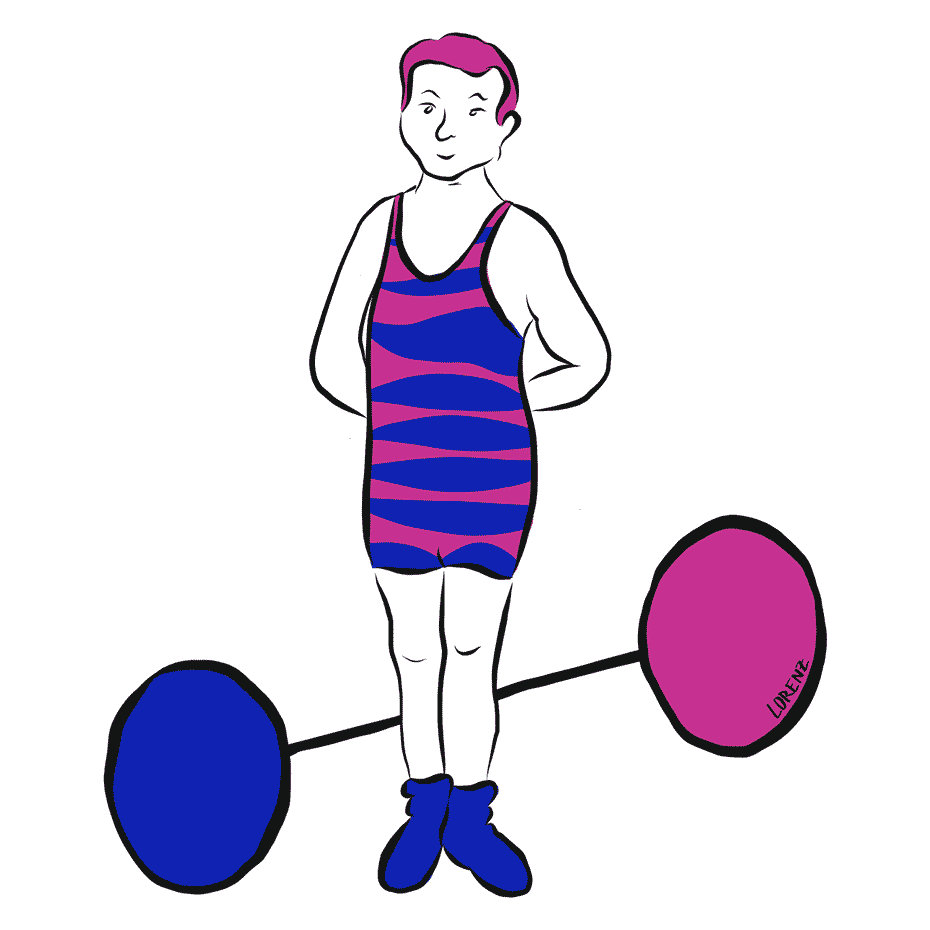
Es heißt, die Stärken seien hervorzuheben, das Kind solle nicht mit leichtfertig Defiziten konfrontiert werden. Gut. Das ist verständlich. Schule soll ja keine Mangelwirtschaft sein. Wie aber überall, so auch hier: Der Ton macht die Musik.
„Sie müssen jetzt ganz stark sein.“, sagt die Kommissarin, wenn sie in die Küche kommt, um eine schlimme Nachricht kundzutun. Der Witwer ist jetzt gefordert, sich zusammenzureißen, alle Sinne beisammenzuhalten. Er soll jetzt die Distanz zu seinen Emotionen wahren. Und meist gelingt das ja auch.
Stark soll auch der Auftritt der Abgasingenieurin sein. Sie muss in ihrer Präsentation mit allem aufwarten, was den Diagrammen Autorität verleiht und was die strukturellen Lücken im System kaschiert.
Noch bevor die Bildungspläne der Ländre den Begriff Kompetenz über die Inhalte schoben, wurden bereits in den Kindergärten die Stärken gerastert. „Viel, viel“, rief die Pädagogin, wenn das Kind sich gern im Baueck aufhielt, mit Kindern meist den Radelrutsch um die Ecke schob, im Stuhlkreis plappernd erzählte. „Wenig, wenig“, markierte man, so jenes Kind sich nicht mit Mädchen abgab, den Kuchen nicht teilte oder die anderen vom Schoß der Tante stieß.
Der Kindergarten der zurückliegenden Dekaden war noch vor der Schule die Schule des Beobachtens. „Der kleine Timmy kann schon acht Klötze stapeln“, wurde im Kompetenzraster angekreuzt. „Das ist jetzt aber noch keine Stärke, gell?“ – Nein, die Begeisterung galt vermutlich mehr der veränderten pädagogischen Perspektive, die die Gegebenheit dokumentierte. Bis jetzt scheint der kleine Timmy nur die Möglichkeit zu haben, acht Bauklötze aufeinanderzuschichten. Noch ist kein neunter draufgesetzt. Würde man den Knaben fragen: „Was kannst du?“, könnte er von seiner Möglichkeit berichten, bis zu einer gewissen Höhe Quader türmen zu können. „Prima, das ist deine Leistung“, sagt der Marbacher Pädagoge, „schichte weiter! Sicher fällt dir ein, eine Burg zu bauen, mit Türmen im Viereck?
Die Türme müssen stehen, die Mauern den Angreifern aus der Puppenecke widerstehen. „Wenn deine Feste stabil ist, dann wird sich die Stärke erweisen.“ Das Defizitäre wird anschaulich, wenn es heißt: „Der Turm stürzt ein.“ – Dann musst du ganz stark sein, Kleiner.“
Anschlussgedanken wollen lauten: „Kompetenzen sind Befugnisse“ und „Leistung lässt sich an fünf Fingern ablesen“.